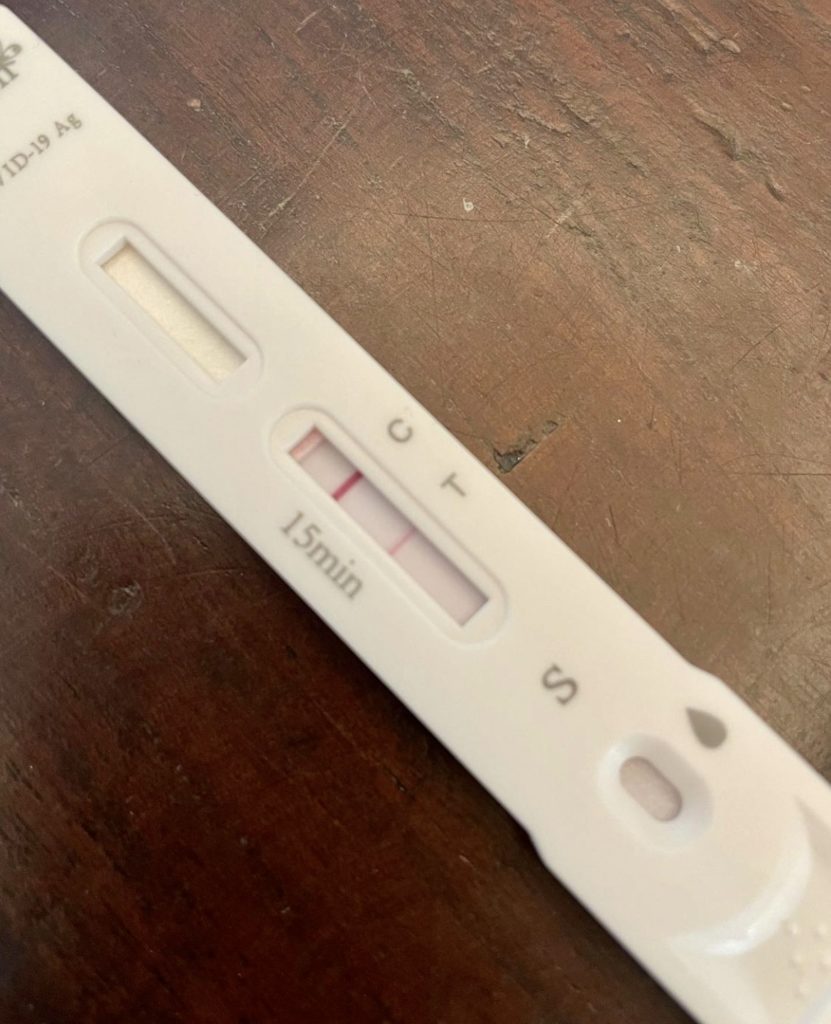Warum Skrupellose gern übers Gendern reden

Strommarktdesign. Gaspauschale. Energiemix. Speicherkapazitäten. Flüssiggas-Terminals. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren. CO2-Bepreisung. Inflation. Rezession. Reservebetrieb. Der Kolonialismus der britischen Krone.
Na, elektrisiert?
**************
Winnetou. Der Tod der Queen. Lange Haare bei Männern. Maskenpflicht. Weihnachtsmärkte. Das gemeinsame öffentliche Trauern von William, Harry, Kate und Meghan.
Na, interessiert?
Ich bemerke, dass ich mich durchaus dazu motivieren muss, mich mit den zuerst genannten Themen eingehend zu beschäftigen. Ich trete mich trotzdem in den Hintern, weil das zu meinem Berufsprofil gehört und es mir unangenehm wäre. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass es mir ungleich mehr Disziplin abverlangt, mich diesen zu widmen als beispielsweise den in der zweiten Auflistung genannten wie etwa der Maskenpflicht. Oder dem Tod der Queen.
Für Letzteres gibt es zwei Gründe: Man kann da mitreden, ohne groß vorgebildet zu sein, erstmal zumindest. Im unmittelbaren Augenblick des Ereignisses reicht ein Austausch über Emotionen. Die Phase, in der Hintergründiges ausgetauscht wird, kommt erst später. Zum einen funktionieren Medien so, zum anderen erfordert das im konkreten Fall auch das Konzept namens „Pietät“. Zweitens erinnert mich paradoxerweise der Tod der Königin Elisabeth an meine Kindheit, also an eine Zeit, in der ich mir noch keine Sorgen machen musste. Das ist inzwischen anders. Klima, Wirtschaft, Pandemie. (Fast hätte ich hinzugefügt, dass natürlich viele Menschen viel größere Sorgen haben als ich, aber wir sind hier ja nicht bei Twitter, weswegen ich mal optimistisch davon ausgehe, dass man mir hier nicht gleich wieder unterstellen wird, dass ich nur zu einem in der Lage bin: Mir Sorgen um mein Umfeld und mich zu machen ODER um andere.)
So. Weiter. Es ist ja erstmal ein Zeichen von funktionierender Selbstfürsorge und intakten Abgrenzungsmechsnismen, wenn man den komplizierten und auch bedrohlichen Themen andere vorzieht. Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist das, was uns gesund hält, so hab ich das mal gelernt. Je nach Disposition tendiert man mehr zum einen oder zum anderen, und noch mal je nach Disposition ist man entweder in der Lage oder willens (das ist ein Unterschied, beides kommt vor), sich auch zur Beschäftigung mit dem anderen hin zu disziplinieren. So wie die Queen – sehen Sie, geht schon wieder los. Es zieht mich zum Profanen. Meine Entschuldigung lautet: Sonntag.
Konsequenterweise schweife ich ab, aber: Zurück zum Thema. Es ist also total menschlich und logisch (psycho-logisch), sich lieber mit Profanem zu beschäftigen. Das Ganze wird sogar durch einen Namen geadelt (ich kann es nicht lassen, tut mir Leid): Wir haben es hier mit dem Law of triviality zu tun.
Dieses besagt, dass es uns Menschen einfach viel näher liegt, uns mit Trivialem zu beschäftigen – vor allem in Anbetracht von zu treffenden weitreichenden, komplexen Entscheidungen. Ironie der Geschichte: Als Beispiel für seine These wählte ihr Aufsteller, ein Mann namens C. Northcote Parkinson, ein fiktives Komitee, das sich mit dem Bau ausgerechnet eines Atomkraftwerks beschäftigen sollte. Stattdessen beschäftigte sich das Komitee aber lieber mit Fragen wie: Aus welchem Material soll der Fahrradschuppen für die Mitarbeiter:innen (ich mach das jetzt wieder) bestehen?
Man kann sie nur allzu gut verstehen, diese Mitglieder des Komitees, oder? Atomkraft – krasse Entscheidungen. Und eben komplexe. Viele Variablen müssen berücksichtigt werden, übereinander gelegt, miteinander kombiniert, gegeneinander gestellt. Viel Input braucht man dafür – und damit auch viel Zeit. Das Potenzial, Fehler zu machen, ist hoch. Und das Ausmaß der möglichen Folgen möglicher Fehler potenziell katastrophal. Dystopisch.
So ein Fahrradschuppen kann also entweder eine Ersatzhandlung sein, oder eine Etappe. Um sich zu motivieren. So wie wenn ich an einem schwierigen Text sitze, nicht weiterkomme oder auch einfach unzufriedne bin, und dann erst mal den Backofen putze. Ich hab dann was geschafft. Ich bin zu etwas in der Lage, mein Selbstbewusstsein freut sich, trau ich mich wieder an den Text ran.
Ist der Text für einen meiner Arbeitgeber oder Auftraggeber gedacht, muss ich ihn zu Ende schreiben. Sonst kriege ich ein Problem. Sollte das ausgedachte Komitee sich ausschließlich mit allem anderen außer der ihm eigentlich zugedachten Aufgabe beschäftigen, hat es das auch. Seine Mitglieder verlieren an Glaubwürdigkeit und Reputation, der Bau des AKW könnte veschleppt werden, woran energiepolitische Planungen und Arbeitsplätze hängen. (Ich argumentiere hier völlig ideologiefrei.)
Wenn Politik sich an Profanem abarbeitet oder aber überaus komplexe Probleme so weit herunterprofanisiert, dass sie plötzlich sehr einfach zu beantworten scheinen und in Folge sehr schlecht gelöst werden, ist das auch menschlich. Niemand hat heutztage noch Zeit, die nächste Wahl in irgendeinem Bundesland steht an, und eine Fehlerkultur besitzen wir hier auch nicht. Die Fronten sind hart, das Lauern ist spürbar, Gnade hat in Zeiten von Inflation und drohender Rezession keine Hochkonjunktur.
Wenden politisch Handelnde also das Law of triviality an (ob bewusst oder unbewusst, egal), ist das menschlich – aber auch sehr verantwortungslos. Leider ist das aber für manche Politiker überhaupt kein Probem, zum Beispiel intellektuell. Die meisten von ihnen sind locker in der Lage, im Grunde alles so weit herunterzubrechen, dass die Wähler am Ende die Wahl haben zwischen Schwarz und Weiß. (Wie übrigens das Gender-Thema. Ganz so einfach ist das alle ja gar nicht.) Nur schlichte Menschen denken, alle oder auch nur die meisten Politiker wären dumm.
Moralisch sind einige Politiker dazu in der Lage. Oder, um es klar zu benennen: Einige haben keine Skrupel, das zu tun.
Manchen Menschen gelingt es auf der anderen Seite nicht, sich mit dem Nicht-Trivialen zu beschäftigen. Die Gründe dafür sind individuell, also äußerst unterschiedlich. Eines ist ihnen aber gemeinsam: Auf sie zielen die Skrupellosen. Die Populisten. Und die Extremisten. Leider bekommen dann nicht nur sie ein Problem. Sondern wir alle.