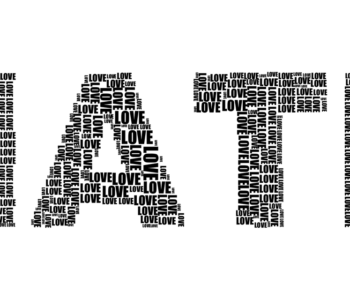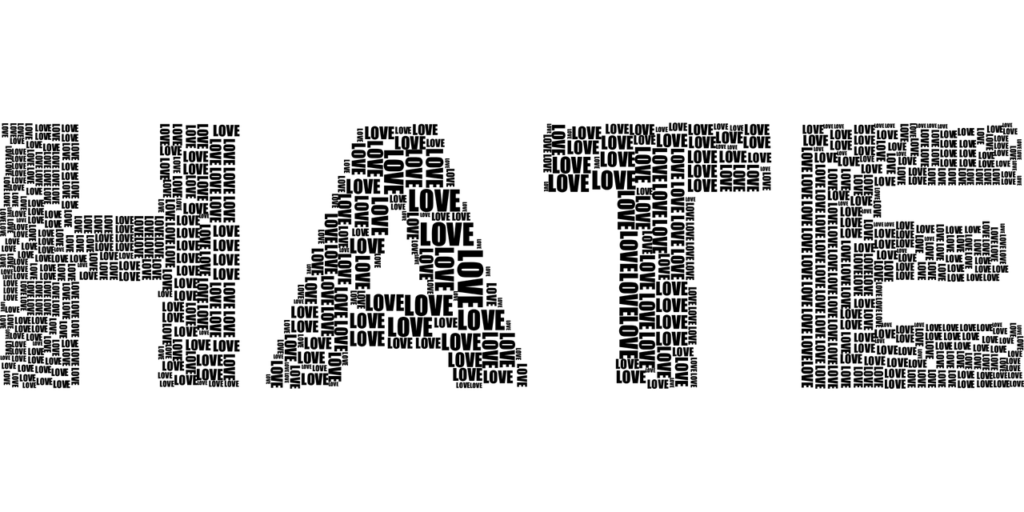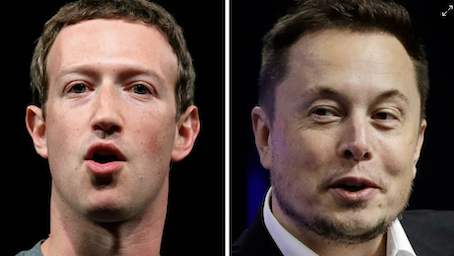Uncategorized
Uncategorized
„Sag mal, der Thomas Gottschalk…“

Ein paar Jahre lang war ich beruflich viel unterwegs, vor allem im Ausland, und flog häufig über Frankfurt. Oft übernachtete ich dann vor meiner Heimreise nach Berlin noch bei meiner Freundin M. in Frankfurt, was eigentlich immer sehr schön war. Eigentlich.
Denn M. war damals noch mit einem Mann verheiratet, der mich regelmäßig mit massiv enthusiastischer Entrüstung mit dem konfrontierte, was er für unfassbare Verfehlungen meines Arbeitgebers hielt.
Thomas Gottschalk zum Beispiel lieferte zuverlässigen Monologstoff. Ich hätte das gut ertragen, mein Gott, es gibt weitaus Schlimmeres, zumal nach Reporterinneneinsätzen in Krisengebieten. Da ist auch ein sich angeblich wie eine offene Hose benehmender Thomas Gottschalk an wohltuend ausgleichender Seichtigkeit als Gesprächsstoff kaum zu überbieten.
Nur knüpfte M.s damaliger Mann seine ausschweifenden und seinem Blutdruck, behaupte ich jetzt natürlich als Laiin, nicht zuträglichen Tiraden stets mit einer mal mehr, mal weniger ausgesprochenen Aufforderung: Ich möge das doch bitte mal weitertragen. An wen, das ließ er offen. Deshalb handelte es sich auch nicht um Gesprächsstoff – ich stellte nach kurzer Zeit sämtliche Reaktionen ein. Denn ich sah und sehe mich da nicht und ließ es deshalb stoisch an mir abperlen. Ob M.s damaliger Mann das überhaupt gemerkt hat, kann ich gar nicht so wirklich sagen. Er machte jedenfalls unverdrossen und ungedrosselt weiter.
Nun ist die Hochzeit der Hochzeiten in meinem Freundeskreis längst vorbei. Und damit auch die Idee, Filme oder Zeitungen für diese Anlässe zu erstellen Natürlich werden die an uns Journalisten herangetragen, und das möchte ich bitte völlig frei von Unterton gelesen wissen. Es gibt keinen; ich finde das total logisch.
Im Alltag aber ist mein Beruf wenig anwendungstauglich für das, was ja zum Beispiel Anwälte stets beklagen (ich möchte diesen Wortwitz als gewollt gelesen wissen, 8 Stunden Schlaf, jaha!), oder auch Ärztinnen und Ärzte: das berühmte „Kannst du mal kurz?“. Niemand braucht im Alltag einen Artikel geschrieben oder einen Nachrichtenbeitrag geschnitten. Meine politische Meinung, danach wird oft gefragt, klar – aber mal ehrlich: Wer redet in diesen Zeiten nicht über Politik?
Ich äußere mich allerdings nur in sehr kleinem Kreis zu meinen persönlichen politischen Ansichten, weil überraschend viele Leute tatsächlich glauben, Journalisten wären a) sowieso alle rotgrün oder aber b) (noch lustiger) ohnehin angehalten, keine politische Meinung haben, weil sie c) leider zu doof sind, die aus ihrer Berichterstattung rauszuhalten. Das ist leider eine Stufe, auf der ich gar nicht mehr diskutiere, weil man da bei Null anfangen müsste, und deshalb kennen echte Freunde meine politischen Ansichten, und andere nicht. Die Zahl derer, die meinen, sie zu kennen, ist natürlich ungleich höher, aber gut, das gehört bei manchen zur Selbstaffirmation, sollen sie also. Das hat mit mir ja wenig zu tun.
In Grunde genauso wenig wie das Verhalten von Thomas Gottschalk in „Wetten dass…?“. (An dieser Stelle übrigens ein Hörtipp: Mike Krüger war gerade zu Gast im Podcast „Die Nilz Bokelberg Erfahrung“. Es ist so ein schönes Gespräch! Als ungebrochen großer „Vier gegen Willi“-Fan bin ich Mike Krüger sowieso sehr zugeneigt. Nun bin ich es noch ein bisschen mehr. )
Und trotzdem schreiben mir Leute im Grunde genommen ständig, ich solle doch mal dieses im Sender ansprechen oder t-online auf jenes hinweisen. Und reagieren erstaunt bis unwillig, wenn ich darauf hinweise, dass es meistens Themenbereiche berührt, die mit meiner Arbeit UND Rolle gar nichts zu tun haben. Es ist nicht so, dass ich intern keine Kritik üben würde – aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, Anmerkungen weiterzutragen. Dazu fehlt mir die Zeit, und, ich formuliere es gern ehrlich, auch die Lust. Zumal die Leute, die mir das auf SoMe schreiben, ja eh gerade dort sind – und das Ganze direkt an die Accounts meiner Arbeitgeber richten könnten. Folgen bedeutet nicht befreundet sein, alte Bauernweisheit.
Aber ich will mich nicht beklagen. M. ist mit diesem Mann inzwischen nicht mehr verheiratet, also erreichen mich seine Wutanfälle auch nicht mehr. Und darüber hinaus: Was müssen wohl Leute aushalten, die für Rüstungskonzerne arbeiten? Oder gar für Elon Musk? Sehen Se.